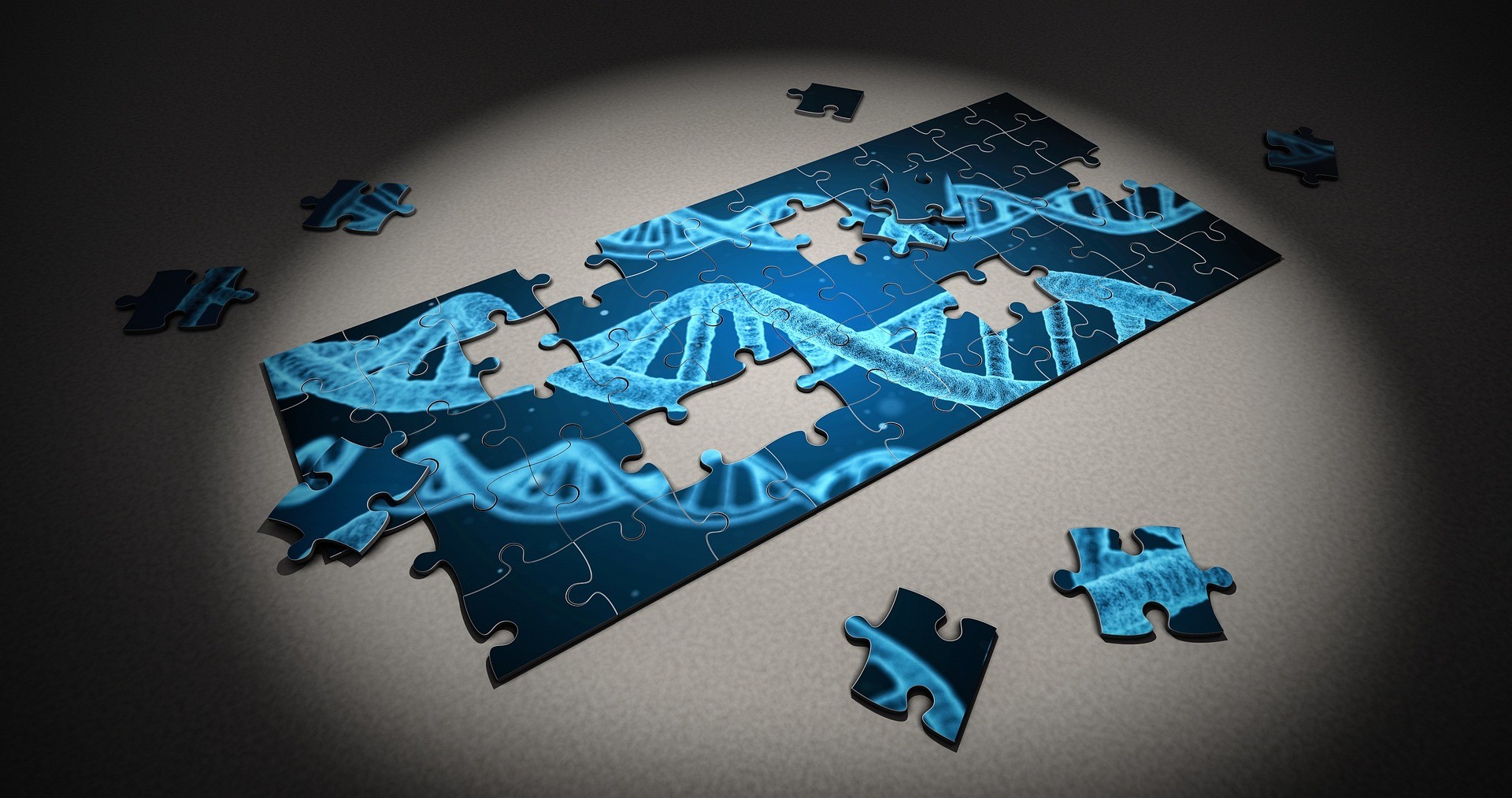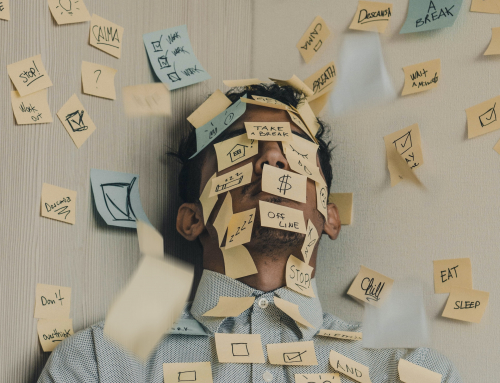Sind Depressionen genetisch veranlagt? Oder werden sie vor allem durch schwere Schicksalsschläge ausgelöst? Ein Dr. Andreas Hagemann erklärt, was Schwermut wirklich verursachen kann und was ins Reich der Mythen gehört.
Ob Diabetes oder Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall – bei vielen Erkrankungen hat die erbliche Veranlagung wesentliche Bedeutung. Selbst bei der Entstehung von Depressionen spielt die Genetik eine Rolle: „Leiden Verwandte ersten Grades unter Depressionen, so liegt das Risiko selbst depressiv zu werden nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bei etwa 15 Prozent, was etwa dem Doppelten des Durchschnittswertes entspricht“, sagt Dr. Andreas Hagemann, Ärztlicher Direktor der Privatklinik Merbeck. Bei eineiigen Zwillingen liegt die Wahrscheinlichkeit zu erkranken sogar bei 50 Prozent, wenn ein Zwilling an Depressionen erkrankt ist. „Doch noch entscheidender als die genetische Prädisposition sind die erworbene Veranlagung und Umweltfaktoren“, betont der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Darunter verstehen Experten die Art und Weise, wie jemand gelernt hat, mit Stress, Verlusten oder anderen einschneidenden Lebensumständen umzugehen. „Dies sollte nicht zuletzt bereits im Elternhaus erlernt werden“, so Dr. Hagemann. „Bleibt dies aus, weil beispielsweise ein Elternteil selber depressiv ist, gilt dies als wichtiger negativer „Umweltfaktor“.“ Dabei gilt: Wer positiv denkt, der ist gegen Verstimmungen besser gewappnet. Menschen mit negativen Denkmustern gelten in besonderem Maß als depressionsgefährdet. Ebenso wie etwa Zeitgenossen mit hoher Leistungsorientierung oder dem Hang zum Perfektionismus.
Erlernen lässt sich positives Denken durch bestimmte Methoden wie etwa „Positiver Mindset“. „Durch diese Verfahren können wir besser mit Stress oder seelischen Verletzungen umgehen bzw. eine konstruktivere, positivere Denkweise entwickeln“, versichert der Experte. Der psychologische Hintergrund: Gehe ich Herausforderungen oder Probleme mit einer positiven Einstellung an, so stellen sich Körper und Psyche erfahrungsgemäß entsprechend darauf ein.
Sind Pessimisten besonders depressionsgefährdet?
„Natürlich haben „Schicksalsschläge“ wie der Tod des Partners oder die Kündigung des Jobs gravierenden Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden“, betont Dr. Hagemann. Doch in der Regel führt nicht ein einziger Auslöser zur Depression, sondern die Wechselwirkung biologischer Faktoren (Hirnstoffwechselstörungen) sowie psychosozialer Momente. Dazu zählen etwa die private Trennung vom Lebenspartner oder der Jobverlust. „Vielfach führen auch alltägliche Überforderungen – wie etwa die Pflege eines schwer erkrankten Angehörigen – in die psychische Krise“, erläutert der Experte. „Und auch die soziale Isolation, der Verlust des geregelten Tagesablaufes (z.B. durch Homeoffice) und der fehlende Austausch mit anderen Menschen in der derzeitigen Pandemie sind nicht zu unterschätzende Faktoren.“
Kann auch Übergewicht depressiv machen?
Dazu Dr. Hagemann: „Das Übergewicht Depressionen auslösen kann, belegen verschiedene Studien. Denn: „Vielfach beeinträchtigen Diskriminierung und Vorurteile Selbstwertgefühl und Stimmungslage.“ Darüber hinaus steigt das Depressionsrisiko bei übergewichtigen Menschen durch deren erhöhte Produktion von Zytokinen (Botenstoffen) und die dadurch zunehmenden Entzündungsprozesse. Nach neuesten Erkenntnissen sind ca. 25 Prozent aller stark übergewichtigen Menschen depressiv.
Auch das zunehmende Alter wirkt sich auf unsere Stimmungslage aus. Depressionen betreffen zwar alle Generationen, doch im Alter wächst das Erkrankungsrisiko. Wissenschaftler gehen davon aus, dass schätzungsweise zehn bis 20 Prozent aller Rentner über 65 betroffen sind. „Eine der Ursachen liegt sicherlich an der täglichen Konfrontation mit Krankheit und Verlust sowie Einsamkeit und Isolation“, sagt Dr. Hagemann.
Eine fachgerechte professionelle Behandlung ist generationsübergreifend das A und O. Bei (mittel)schweren Symptomen hat sich auch bei älteren Menschen die Kombination aus Psychotherapie und Antidepressiva bewährt. Lebensfreude und psychische Stabilität nehmen wieder zu. „Aufgrund der häufig im Alter bereits bestehenden Einschränkungen sind jedoch besondere Kenntnisse von Wechselwirkungen und Risiken einer Psychopharmakotherapie erforderlich“, betont Dr. Hagemann.